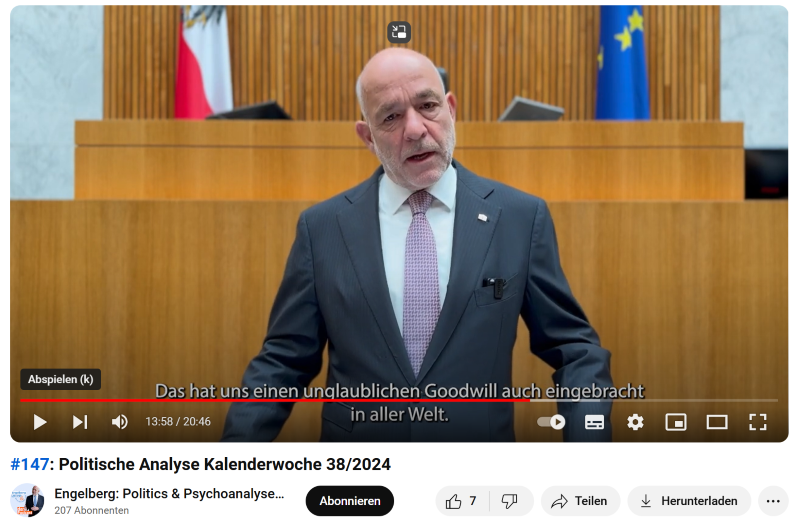Kommentare
Die Machtbalance gehört nachgebessert

Es ist eine sensible Balance: Die Mehrheit, die Minderheit und der Einzelne. Demokratie fand im antiken Griechenland ihren Ursprung. Das Wort selbst ist griechisch: krátos ist die Macht und dḗmos ist das Volk. So gesehen bedeutet Demokratie, die Macht sei dem Volke zu eigen. Lateinisch ist populus das Volk. Aber Demokratie klingt gut in unseren Ohren, während wir vom Wort Populismus, welches das Gleiche bedeutet, unangenehm berührt sind. Warum ist das so? Eine Analyse und eine Schlussfolgerung von Univ.-Prof. Dr. Rudolf Taschner, Abgeordneter der ÖVP.
Was bedeutet denn Mehrheit?
Ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es um die Demokratie nämlich nicht bestellt. Einfach ist nur, ihr Prinzip zu beschreiben: Es gilt, Macht auszuüben. Mächtig ist, wer festlegt, was sein soll. Der deshalb Gesetzgeber heißt. Und dies soll in der Demokratie das Volk selbst sein, jenes Volk, das seinerseits diese Gesetze befolgt – das ganze Volk, ohne Ansehen der Person. Wohingegen beim Erlassen der Gesetze nicht das ganze Volk entscheidet, sondern „die Mehrheit“ – wobei noch unklar ist, was unter „der Mehrheit“ zu verstehen sei.
Die radikale Demokratie, die Jean-Jacques Rousseau vorschwebte und in der jede Entscheidung direkt von der Mehrheit des ganzen Demos getroffen wird, ist nicht bloß unpraktikabel, sie mündet wegen des in ihr lauernden Widerspruchs – die Mehrheit des Volks als Gesetzgeber und das ganze Volk als Gesetzbefolger – schnurstracks in die Diktatur populistischer Volksverführer.
Macht ist zeitlich begrenzt verliehen
Vernünftiger ist es, das Wesen von Demokratie darin zu erblicken, dass aufgrund einer von einer Mehrheit des Demos getroffenen Wahl hinreichend vielen Mandataren im Parlament und in der Folge einer Regierung Macht auf Zeit überantwortet wird. Danach wählt der Demos erneut und bestätigt entweder sein ursprüngliches Votum, oder er erzwingt einen gewaltlosen Machtwechsel. Gewaltlos, also ohne Ausnützen der geliehenen Macht – dies ist das Adjektiv, auf das es ankommt.
Doch was ist mit jenen, die in der Minderheit sind? Streng genommen müssten sie in Ohnmacht verharren. Doch selbst wenn diese Minderheit auf lange Sicht nie die Mehrheit erlangt, auch in Koalition mit anderen Minderheiten nie die Mehrheit stellen wird, ist ein demokratisch verfasster Staat gut beraten, Minderheiten Rechte zuzugestehen. Nicht weil es Toleranz geböte – Toleranz bedeutet eigentlich Duldung, und es spricht der Selbstachtung selbst der mickrigsten Minderheit Hohn, bloß geduldet zu sein. Sondern weil die Geschichte lehrt, dass ein demokratisch verfasstes Gemeinwesen nur dann stabil bleibt, wenn Minderheiten Rechte besitzen.
Wie weit dürfen Minderheitenrechte gehen?
Darum ist es sinnvoll, dass zum Beispiel das österreichische Parlament in seiner Geschäftsordnung minderheitenfreundlich organisiert ist. Wie weit aber sollen Minderheitenrechte gehen?
Die Frage stellt sich umso schärfer, je lauter Minderheiten ihre Anliegen zur Geltung zu bringen versuchen. Und manchen von ihnen gelingt es hervorragend, den Zeitgeist für sich zu vereinnahmen – so sehr, dass es gar erstrebenswert scheint, sich einer aufdringlichen Minderheit in vorauseilender Devotheit anzudienen. Vor allem dann, wenn sie mit ihren Parolen die schweigende Mehrheit verunsichert und diese sich scheut, die ihr zustehende Macht im Sinne ihrer Interessen auszuüben. Wir alle kennen Beispiele. Es ist hier nicht nötig, sie in einer notgedrungen unvollständigen Liste aufzuzählen.
Unerwünschten Nebenwirkungen
Nur eines sei erwähnt, weil es uns derzeit in seinen Auswirkungen beschäftigt: Die Einsetzung von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen ist ein Minderheitenrecht: Der Nationalrat hat seit dem Jahre 2015 die Pflicht, auf Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder diesem nachzukommen. Allerdings lehrt die Erfahrung, dass der Vollzug dieses außerordentlich scharfen parlamentarischen Kontrollrechts der Minderheit nicht befriedigend gelingt.
So wurde im letzten sogenannten „Ibiza-Untersuchungsausschuss“, der eigentlich Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung heißt, verglichen mit den eher dürren Erkenntnissen, die manche dem Ausschuss zu verdanken vorgeben, mehr Porzellan zerschlagen als erträglich ist: Es wurden das Ansehen der vom Ausschuss unangemessen Punzierten wie auch das Ansehen der im Ausschuss Tätigen beschädigt. Und dass damit Akzeptanz und Ansehen der parlamentarischen Demokratie Schaden leiden, sollten weder die verantwortungsbewussten Vertreter der Mehrheit und schon gar nicht jene der Minderheit gutheißen.
Verfahrensordnung sinnvoll adaptieren
Die Lösung besteht nicht in einer Rücknahme des Minderheitenrechts, sondern in einer auf dieses Minderheitenrecht sinnvoll adaptierten Verfahrensordnung bei Untersuchungsausschüssen. Denn Mehrheit wie Minderheit müssten daran interessiert sein, dass die Arbeit des Ausschusses in Einklang mit dem Bemühen um Wertschätzung des Parlaments erfolgt.
Man könnte zum Beispiel die Befragung von Auskunftspersonen allein den Verfahrensrichtern überlassen, wobei diese sich an den von den einzelnen Parteien aufgelisteten Fragen orientieren; Wortmeldungen der Mitglieder des Ausschusses bestünden in Bewertungen von Sachverhalten und Aufzeigen von Unklarheiten und vermeintlichen Widersprüchen, um deren Klärung sich wiederum die Verfahrensrichter bemühen. Dies ließe untergriffige Polemik kaum mehr zu, und eine derart sachlich gestaltete Verfahrensweise könnte – falls keine vertraulichen Tatbestände erörtert werden – der interessierten Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden. Dies ist, ins Unreine formuliert, nur eine mögliche Idee von vielen, wie ein sinnvolles Minderheitenrecht in gutem Sinne genützt werden könnte.
Ist der Einzelne machtlos?
In einer noch schwächeren Position als jener von Minderheiten befindet sich in einem demokratisch verfassten Staat die einzelne Person. Dies liegt zwingend am Wesen einer Gemeinschaft von vielen. Es gibt, abgesehen von Spielarten der Monokratie, keine Staatsform, in welcher dem Einzelnen Macht ungeteilt überantwortet wird – und bei der Monokratie, der Herrschaft eines Einzelnen, fragen sich alle anderen mit vollem Recht: Warum dieser und nicht ich?
Der Einzelne verfügt in der Demokratie über Macht, wird zuweilen argumentiert. Denn er vermag in der Wahlzelle zu entscheiden, wie in der nächsten Legislaturperiode zu regieren ist. Man darf an der Überzeugungskraft dieses Arguments zweifeln, wenn man bedenkt, dass die Stimme des Einzelnen im Stimmengemenge der vielen praktisch keinen Einfluss nimmt. Bei der Präsidentschaftswahl 1980 in den USA, als Ronald Reagan gegen Jimmy Carter antrat, erlebte ich dies besonders deutlich: Der damals vor Kurzem gegründete Nachrichtensender CNN verkündete als Erster, dass Reagan zum Präsidenten gewählt ist, und zu diesem Zeitpunkt hatten die Wahllokale in Hawaii noch nicht einmal geöffnet! Welchen Wert hatte noch eine Stimme, die bei dieser Wahl in Honolulu abgegeben wurde?
Allein der Respekt allen Einzelnen gegenüber ist es, der ein demokratisch verfasstes Staatswesen gegenüber anderen Staatsformen auszeichnet: Denn jene, die Macht vom Volk auf Zeit überantwortet erhielten, wissen, dass sie auf die Stimmen der Einzelnen angewiesen sind, wenn sie diese Macht behalten wollen.
Staat hat Freiheit und Sicherheit zu geben
Hierzu gesellt sich ein zweiter Aspekt, der vielleicht noch wichtiger ist: So wie es einem demokratisch verfassten Staate gut ansteht, Minderheiten Rechte zuzugestehen, ist er auch dazu verpflichtet, jedem Einzelnen nicht nur Sicherheit zu geben, sondern auch Freiheit zu gewähren: Bedingte Freiheit in der Gestaltung des Zusammenlebens mit anderen und absolute Freiheit in der Gestaltung des eigenen Daseins. „My home is my castle“, sagt man in England zurecht, jenem Land, in dem Thomas Hobbes mit nüchternem Blick die erste moderne Staatstheorie entwarf. In das Schloss, das das eigene Heim ist, darf kein anderer eindringen, am allerwenigsten der Staat. Es sind Schutz und Bewahrung des Privaten, die, wie es in der amerikanischen Verfassung heißt, Life, Liberty and the pursuit of Happiness, Leben, Freiheit und das Streben nach dem Glück, ermöglichen.
Staat der Entmündigten macht Demokratie zur Farce
Man mag diesen Aspekt für selbstverständlich halten. Aber das ist er leider nicht. In sogenannten „Wertegemeinschaften“ – die der Nationalsozialisten und der Kommunisten sind deren grässlichste Beispiele – spähten Blockwarte in die privatesten Sphären. Auch der Spruch „Alles Private ist politisch“, geprägt von den Vorkämpfern der 68-er Bewegung, zielt in die Zerstörung des Privaten und die Entmündigung des Einzelnen. Noch hallt dieser Spruch in Köpfen etatistischer Ideologen nach. Sicher: ein Staat der Entmündigten ist leicht zu regieren. Doch in ihm wäre Demokratie eine bloße Farce.